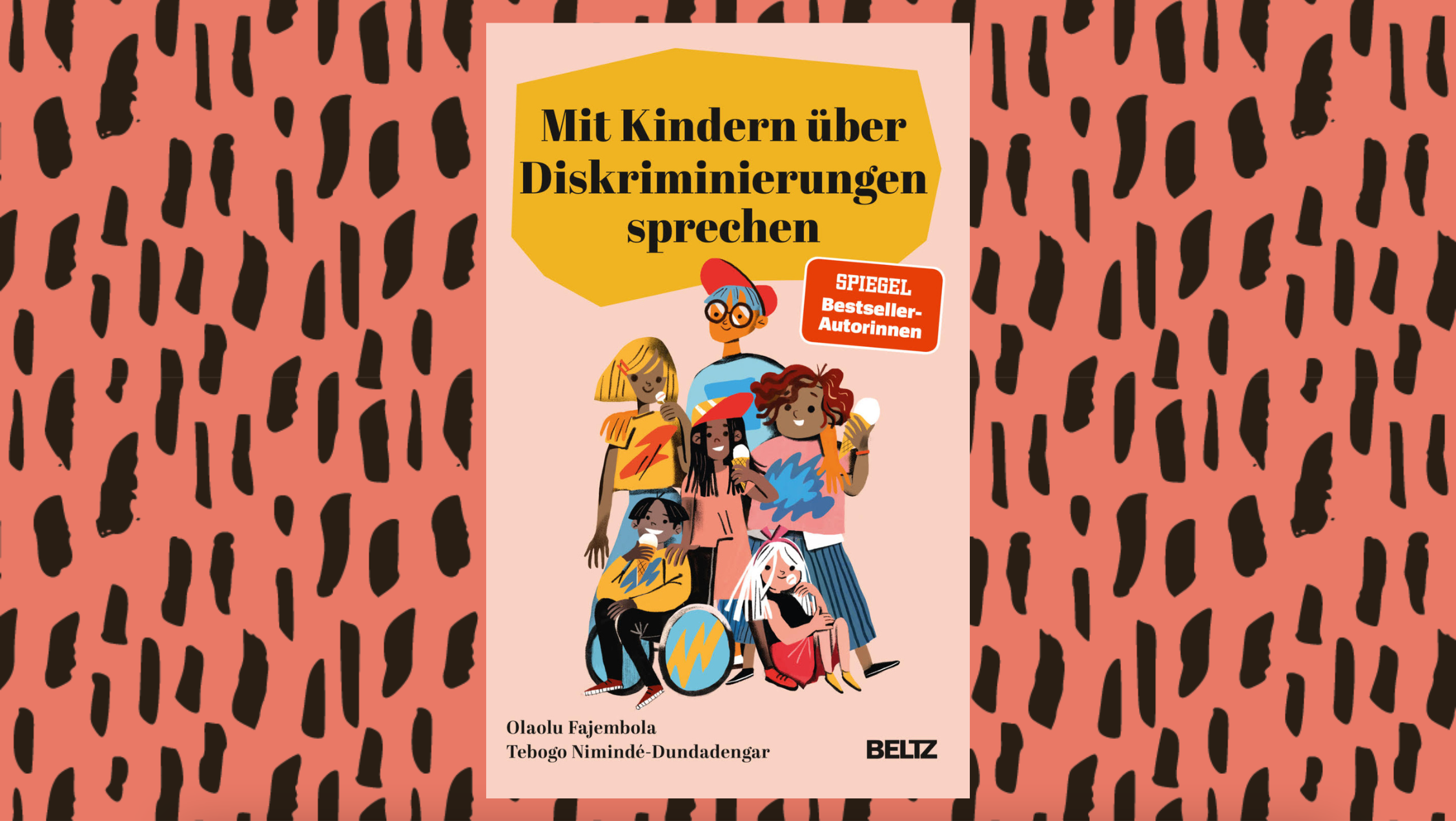Kinder werden nicht mit Vorurteilen geboren – aber wie können wir mit ihnen über Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten sprechen? Unsere Autorin Karina Sturm hat das neue Buch zu diesem Thema von Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar gelesen und mit Fajembola gesprochen.
„Du siehst ja gar nicht behindert aus!“ „Wo kommst du denn ursprünglich her?“ „Hast Du zugenommen?“ – All diese Fragen sind diskriminierend für verschieden marginalisierte Communities, weil sie stereotype Annahmen und Vorurteile widerspiegeln.
So impliziert die erste Frage, dass Menschen mit Behinderungen ein bestimmtes Aussehen haben (meist wird dabei an Rollstuhlfahrende gedacht). Sie ignoriert die Tatsache, dass viele Behinderungen nicht sichtbar sind, was Menschen mit unsichtbaren Behinderungen weiter stigmatisiert. Die zweite Frage vermittelt Menschen mit (tatsächlicher oder zugeschriebener) Zuwanderungsgeschichte, dass sie trotz ihres Lebens in einem Land nicht wirklich dazu gehören, was ein Gefühl des „Andersseins“ verstärkt. Und die Nachfrage in Bezug auf das Gewicht impliziert, dass Gewichtszunahme etwas Schlechtes ist, was zu Body Shaming und Unsicherheiten führen kann. Diese Aussagen sind nur einige Beispiele für Diskriminierungserfahrungen, mit denen marginalisierte Gruppen in ihrem Alltag konfrontiert werden.
„Mit Kindern über Diskriminierung sprechen“: ein intersektionales Buch zum Abbau von Diskriminierung
In ihrem Buch „Mit Kindern über Diskriminierung sprechen“ gehen die beiden Autorinnen Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar noch auf viele weitere Diskriminerungsformen ein, z. B. differenzieren die Autorinnen Rassismus weiter, schreiben über Antisemitismus, Anti-Gender-Diversity, sowie über Klassismus.
Es ist das erste Sachbuch, das einen Einblick in die verschiedenen Diskriminierungsformen vor allem in Bezug auf die Erziehung von Kindern gibt und so eine dringend benötigte Anleitung für Eltern, Erzieher*innen und alle, die mit Kindern arbeiten, im Umgang mit Diskriminierung bietet. Und gerade in heutigen Zeiten mit zunehmenden Einfluss nicht demokratischer, rechter Parteien ist es wichtig, dass Kinder diskriminierungssensibel aufwachsen. Denn Kinder werden nicht mit Vorurteilen geboren – sie erlernen diese. „Bereits im Alter von drei bis sechs Monaten erkennen sie phänotypische Unterschiede zwischen Menschen. Im Alter von drei bis fünf Jahren haben Kinder alle gesellschaftlich vorherrschenden Vorurteile erlernt,“ schreiben die Autorinnen in ihrem Buch.
Olaolu Fajembola ist Kulturwissenschaftlerin und gründete zusammen mit Co-Autorin Tebogo Nimindé-Dundadengar den Onlineshop Tebalou, der Spielwaren für Kinder anbietet und dabei besonderen Wert auf Vielfalt legt. „Mit Kindern über Diskriminierung sprechen“ ist Nimindé-Dundadengars und Fajembolas zweites Buch zum Thema Diskriminierung. Mit ihrem ersten Werk „Gib mir mal die Hautfarbe“ thematisieren die Autorinnen, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann. Nun erweitern die beiden den Themenkreis um weitere, oft auch intersektionale, Diskriminierungsformen, denn viele Menschen, die zu einer marginalisierten Gruppe gehören, sind gleichzeitig auch mehrfach diskriminiert.

Tebogo Nimindé-Dundadengar und Olaolu Fajembola
sind Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von Tebalou, Deutschlands größter Onlineplattform für vielfältiges Kinderspielzeug und Bücher.
2021 veröffentlichten sie den Spiegel-Bestseller „Gib mir mal die Hautfarbe - Mit Kindern über Rassismus sprechen.“
Neben ihrer Arbeit als Autorinnen und Unternehmerinnen beraten die beiden heute Fachkräfte und Unternehmen im Bereich diversitätssensibler Pädagogik.
Foto: Cristina S. Salgar
Mit diesem Buch wurde mir nochmal bewusst, wie ähnlich unsere Kämpfe eigentlich sind. Es gibt diese roten Linien, wo wir alle zusammenkommen, nämlich dort, wo es darum geht, was sich gesellschaftlich verändern muss, damit wir alle mitgedacht werden.
Olaolu Fajembola
Intersektionale Diskriminierung
So identifizieren sich z. B. fast 40% aller trans Personen gleichzeitig auch als behindert. 27% der 20-jährigen trans Menschen haben mindestens eine Behinderung. Mit 55 Jahren sind es dann schon 39%, was im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft doppelt so hoch ist. Jeder 10. Mensch mit Zuwanderungsgeschichte lebt mit einer Beeinträchtigung; bei Geflüchteten sogar jeder Fünfte. „Wir müssen in Deutschland noch viel über Strukturen sprechen, wie wir als Gesellschaft miteinander leben und welche Chancen, Ressourcen, Wege zum Glück jede*r von uns hat. Und vor allem auch darüber, ob das wirklich alleinig auf individuellen Entscheidungen basiert… Denn eigentlich hängt vieles davon ab, welche Möglichkeiten wir innerhalb der Gesellschaft erhalten und in welchen Körpern wir uns in der Gesellschaft bewegen“, sagt Fajembola.
Als Schwarze Frauen in Deutschland sind die Autorinnen auch von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen. „Innerhalb der Schwarzen Community gibt es sehr starken Klassismus. Und natürlich haben wir Bekannte, die Schwarz sind und muslimisch oder Schwarz, muslimisch und palästinensisch, was auch nochmal ganz andere Wirkweisen hat.“ Obwohl die Expertise der Autor*innen vor allem im Bereich Anti-Schwarzer Rassismus liegt, wollten sie dennoch aufzeigen, wie ähnlich die Strukturen auch für andere Diskriminierungsformen funktionieren und vor allem auch, dass verschiedene Formen von Diskriminierung, die in einer Person zusammenkommen, nicht separat wirken, sondern sich gegenseitig verstärken. „Mit diesem Buch wurde mir nochmal bewusst, wie ähnlich unsere Kämpfe eigentlich sind. Es gibt diese roten Linien, wo wir alle zusammenkommen, nämlich dort, wo es darum geht, was sich gesellschaftlich verändern muss, damit wir alle mitgedacht werden“, erklärt Fajembola.
„Gerade wenn es um Themen ging, die uns nicht unmittelbar betreffen - mal abgesehen davon, dass wir sehr viel mehr Arbeit in diese Themen investieren mussten - mussten wir herausfinden, wo genau unser Platz ist. In welchen Momenten sind wir Allies oder tatsächlich auch Teil des Problems und tragen eine Täterinnenschaft in uns. Das zu reflektieren war, glaube ich, das Schmerzhafteste, was wir auch immer noch bis heute spüren.“
Olaolu Fajembola
Nichts über uns, ohne uns
Auch ein Kapitel über Ableismus gibt es im Buch, in dem die Autorinnen eine kleine Anekdote aus Ihrem Leben teilen:
„Wir erinnern uns gut an eine Buchpremiere einer Anthologie, zu der wir ein Kapitel beigetragen hatten. Der Saal war mit 400 Plätzen komplett ausverkauft. Nach und nach trafen die Autor*innen ein und wir fingen fröhlich an zu schnattern. Die fröhliche Stimmung trübte sich, als sich herausstellte, dass zwar der Saal, jedoch nicht die Bühne einen barrierefreien Zugang hatte. Damit war klar, dass eine*r der Autor*innen vor statt auf der Bühne würde lesen müssen.“
Solche Situationen sind für behinderte Menschen alltäglich. „Es [Behinderung] ist die Dimension, die als letztes genannt und als erstes vergessen wird“, zitieren die Autorinnen Raúl Krauthausen, den sie als Experten für Ableismus im Buch zu Wort kommen lassen. „Die Dimension Behinderung ist, vielleicht neben der des Migrationshintergrunds, die Einzige, die als Kostenfaktor gesehen wird“, fügt Krauthausen an. Für jedes Kapitel außer dem zu Anti-Schwarzem Rassismus haben sich die Autorinnen Unterstützung aus den jeweiligen Communities gesucht, um nicht für andere zu sprechen. „Natürlich haben wir im Bereich Rassismus eine größere Tiefe und kennen mehr Facetten, weil Rassismus Teil unseres gelebten Alltags ist. Deshalb brauchten wir Expert*innen für alle anderen Themen. Wir wollten dann in diesem Potpourri an verschiedenen Stimmen trotzdem eine gemeinsame Sprache finden, um das Thema Diskriminierung für eine breite Gruppe von Menschen zugänglich zu machen“, sagt Fajembola. „Gerade wenn es um Themen ging, die uns nicht unmittelbar betreffen – mal abgesehen davon, dass wir sehr viel mehr Arbeit in diese Themen investieren mussten – mussten wir herausfinden, wo genau unser Platz ist. In welchen Momenten sind wir Allies oder tatsächlich auch Teil des Problems und tragen eine Täterinnenschaft in uns. Das zu reflektieren war, glaube ich, das Schmerzhafteste, was wir auch immer noch bis heute spüren.“

Worum geht es im Buch?
Jedes Kapitel ist eine Mischung aus Zitaten von verschiedenen Fachleuten und den Zusammenfassungen der Autorinnen mit einfachen Beispielen. Auch werden die Leser*innen konstant zur Selbstreflexion angeregt, indem Fragen gestellt werden, über die sie nachdenken sollen. Im Ableismusteil lautet eine der Fragen: Spreche ich mit meinem Gegenüber dem Alter angemessen oder verfalle ich in eine Sprache, die ich einem Kind gegenüber benutzen würde, obwohl ich mit einem Erwachsenen spreche? Menschen mit Behinderungen, vor allem mit Lernschwierigkeiten, werden oft nicht als erwachsene Menschen wahr und ernst genommen und es wird über ihren Kopf hinweg mit der Begleitperson gesprochen. Doch auch für viele andere behinderte Menschen, vor allem mit sichtbaren Behinderungen, drückt sich Ableismus im Alltag durch Verkindlichung aus.
Gleichzeitig wird auch immer darauf eingegangen, welchen Stellenwert Bildungseinrichtungen in der Bekämpfung der verschiedenen Diskriminierungsformen haben, gefolgt von klaren Empfehlungen auf personeller Ebene, um selbst aktiv gegen Diskriminierung zu werden. Besonders ist auch, dass die Autorinnen zusätzlich am Ende jedes Kapitels auf weitere Literatur, wichtige Jahrestage und die Social Media Links von Aktivist*innen verweisen, sodass die Menschen, die sich nach mehr Information sehnen, sofort tiefer in die Materie eintauchen können.
„Deutschland ist das einzige Land, in dem ,Du bist hier Gast‘ als Drohung zu verstehen ist.“
Auch nutzen Fajembola und Nimindé-Dundadengar schlagkräftige Aussagen aus dem Leben, die wir alle ständig hören und sehen, aber gar nicht bewusst wahrnehmen, um Diskriminierung zu veranschaulichen und für Personen greifbar zu machen, die bislang noch nicht viele Berührungspunkte mit dem Thema hatten. So schreiben die Autorinnen in ihrem Buch, Deutschland sei das einzige Land, in dem das Wort „Gast“ nicht unbedingt eine positive Konnotation trägt. Während Gast zu sein in vielen Kulturen bedeutet, mit Gastfreundschaft und Respekt behandelt zu werden, ist das Wort in Deutschland oftmals als Drohung zu verstehen. Die Person wird nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft gesehen bzw. nur vorübergehend geduldet. Dabei soll die Gästin oder der Gast mal lieber ihre*seine Position nicht vergessen – nämlich, dass sie*er nicht wirklich dazugehört und sich entsprechend zu verhalten hat. Ein ganz klassisches Beispiel von Rassismus.
Ein fragiles Gerüst
Die Autorinnen sind sich sicher, noch vor zehn Jahren wäre ein solches Buch nicht möglich gewesen. „Es hat sich durchaus was bewegt. Heute gibt es so viele Möglichkeiten zur Communitybildung, z. B. die sozialen Netzwerke, über die wir uns weltweit vernetzen können; wir haben Role Models, die aufklären und zunehmend eine Bühne bekommen. Das Wissen über Anti-Schwarzen Rassismus ist im Mainstream angekommen“, erklärt Fajembola. Gleichzeitig, sagt die Autorin, sei aber auch der Konservatismus seit ein paar Jahren am erstarken, was zeige, wie fragil dieses ganze Gerüst eigentlich ist. Auf die Frage, was sie denn machen würde, wenn es plötzlich einfach keinen Rassismus mehr gäbe – eine utopische Frage – sagt Fajembola: „Vielleicht hätte ich ganz andere Interessen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Pädagogin of Color, die früher Mathematik studiert hatte und eigentlich ein totaler Naturwissenschaftsnerd war. Sie hat sich aber angesichts dessen, wie Kindern of Color im Schulkontext die Chancen geraubt werden, für den Bereich Pädagogik entschieden. Wer wäre ich? Vielleicht würde ich ein Fotobuch über Steine machen“ und lacht.
Dieses Buch ist sowohl wichtig für Aktivistinnen als auch für Allies, denn wie Fajembola so treffend formuliert, ist es auf der einen Seite essenziell, „dass gerade wir, die marginalisiert sind, zusammenkommen und voneinander lernen“, während es aber gleichzeitig auch die Aufgabe aller nicht marginalisierten Menschen ist, Diskriminierung abzubauen, denn „die Menschen, die von diesen Diskriminierungsformen betroffen sind und am stärksten darunter leiden, sind müde.
Karina Sturm
Wo anfangen?
„Aber die Kinder spielen doch ganz lieb miteinander und bemerken solche Themen gar nicht, außer wir sprechen sie darauf an.“ Das ist ein Argument, das Fajembola besonders häufig von Pädagog*innen hört. „Kinder besprechen Diskriminierung nicht, aber sie übernehmen ja trotzdem Erklärmuster, aus dem, was sie aus einer Situation lesen“, sagt Fajembola. Um Kinder für Diskriminierung zu sensibilisieren, sei es im ersten Schritt nötig, bei sich selbst zu reflektieren.“ Im nächsten Schritt sprechen wir dann mit den Kindern über Grundsätzliches wie ,Wie gehen wir miteinander um? Wie lernen wir einander verstehen in unserer Unterschiedlichkeit?‘ und dann tasten wir uns langsam an diese Themen ran.“ Das ist kein einmaliges Gespräch, sondern ein stetiger Prozess, der schon früh begonnen werden sollte. Mit ihrem Buch „Mit Kindern über Diskriminierung reden“ tragen Fajembola und Nimindé-Dundadengar dazu bei, diesen Prozess zu unterstützen und bieten wertvolle Anleitungen, um Kindern ein Bewusstsein für Vielfalt, Respekt und Inklusion zu vermitteln.
Dieses Buch ist sowohl wichtig für Aktivistinnen als auch für Allies, denn wie Fajembola so treffend formuliert, ist es auf der einen Seite essenziell, „dass gerade wir, die marginalisiert sind, zusammenkommen und voneinander lernen“, während es aber gleichzeitig auch die Aufgabe aller nicht marginalisierten Menschen ist, Diskriminierung abzubauen, denn „die Menschen, die von diesen Diskriminierungsformen betroffen sind und am stärksten darunter leiden, sind müde.“ Und eigentlich ist jetzt gerade auch genau die richtige Zeit, aktiv zu werden und mit den Kindern von heute eine gerechtere und inklusivere Welt von morgen zu schaffen.