Das deutsche Gesundheitssystem ist wie die Bahn: In der Theorie gibt es viele Verbindungen und einen dichten Fahrplan an Leistungen. In der Praxis jedoch: kaputte Züge, Strecken voller Baustellen, und nicht selten fährt der Zug genau dann nicht, wenn man ihn am dringendsten braucht. Doch was für Gelegenheitspatient*innen eine geringfügige Unannehmlichkeit ist, wird für Menschen mit komplexen chronischen Erkrankungen und Behinderungen schnell existenzbedrohend. Sie erleben nicht nur dieselben strukturellen Probleme wie alle Patient*innen, sondern zusätzlich Diskriminierung, Gaslighting und eine Versorgung, die ihre Lebensrealität ignoriert. Mit einer Mischung aus Betroffenenperspektive, Fakten und Bahn-Analogien zeigt Karina Sturm auf, auf welche Barrieren Personen mit komplexen chronischen Erkrankungen heute im Gesundheitssystem stoßen.
„Bitte rechnen Sie mit einer außerplanmäßigen Verspätung von 14 Jahren.“
Ich bin chronisch krank. Oder wie es manche Gutachter*innen nennen: „alle Frauen sind ein bisschen überbeweglich“. Ein Neurologe sagt: „Sie haben nur Stress“ und die Rentenversicherung „Sie sind zu jung, um krank zu sein“. Willkommen in der Welt der komplexen und unsichtbaren Erkrankungen, in der man Glück hat, wenn man bis zum Rentenalter eine (korrekte) Diagnose erhält.
Ich lebe mit einer Form des Ehlers-Danlos-Syndroms, kurz EDS – eine vererbbare Bindegewebserkrankung, die so selten sein soll, dass sie eigentlich gar nicht existiert, wenn man manchen Ärzt*innen, Gutachter*innen oder dem medizinischen Dienst glaubt. EDS ist aber gar nicht so selten, sondern unter Mediziner*innen nur größtenteils unbekannt und ignoriert. Für die meisten Betroffenen vergehen im Schnitt 14 Jahre bis sie mit EDS diagnostiziert werden – bei Frauen dauert es signifikant länger als bei Männern. Letztere müssen „nur“ vier Jahre durchhalten. Bei der Bahn gibt es wenigstens eine App mit Verspätungsanzeige. Im Gesundheitssystem? Nur das Orakel im Wartezimmer. Viele Betroffene durchlaufen bis zur Diagnose mehr Fachrichtungen als manche Medizinstudierende im praktischen Jahr. 58 Prozent der EDS-Betroffenen konsultieren auf der verzweifelten Suche nach einer Diagnose fünf oder mehr Ärzt*innen, 20 Prozent sogar 20.
„Leider sind Sie im falschen Zug. Bitte steigen Sie in Richtung Psychoschiene um.“
Viele EDS-Betroffene finden so erst im letzten Lebensabschnitt heraus, was der Grund für die diffusen jahrzehntelangen Beschwerden war. Dann ist der Zug aber auch schon abgefahren. Denn durch die fehlende Diagnose, beziehungsweise vor allem auch die vielen Fehldiagnosen, kommt es zu schwerwiegenden Konsequenzen. In über zwei Drittel der Fälle kommt es zu Fehlbehandlungen, die in fast allen Fällen zu gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen.
Machen Sie mal mehr Sport. So junge, hübsche Dinger wie Sie haben immer niedrigen Blutdruck
In den Jahren meiner Diagnose-Suche wurde ich so viele Male geröntgt, dass ich mich oft frage, warum ich noch nicht durch Wände sehen kann. Mir wurden so viele Injektionen verabreicht, dass ich eigentlich ein menschliches Depot für Schmerzmittel sein müsste und ich habe so viele physiotherapeutische Behandlungen ausprobiert, dass ich heute je nach Beschwerdebild meine eigenen Trainingsprogramme zusammenstellen kann. Viele dieser falschen Therapien haben langfristig dazu geführt, dass meine ohnehin zu beweglichen Gelenke nur schneller kaputt gegangen sind. Nichts davon wäre nötig gewesen, hätte auch nur ein Arzt mal an EDS gedacht. In meiner Verzweiflung habe ich viele tausende von Euro in nutzlose oder schädliche Therapien investiert. Doch neben der finanziellen Belastung und den irreversiblen körperlichen Schäden, war das Schlimmste dabei der mentale Schaden, durch das Nicht-Glauben oder das aktive Manipulieren dahingehend, dass ich mir alles nur einbilden würde.
„So beweglich zu sein, kann für Sie aber doch auch Vorteile haben“, sagt ein Arzt zu meinen hypermobilen Gelenken und zwinkert mir dabei zu. „Machen Sie mal mehr Sport. So junge, hübsche Dinger wie Sie haben immer niedrigen Blutdruck“, sagt ein anderer Arzt zu mir, als ich mit lebensbedrohlichen Komplikationen vor ihm sitze. „Sie sind zu jung, um krank zu sein“ – der ewige Klassiker zusammen mit „das bilden Sie sich alles nur ein“. Beide habe ich von diversen Medizinern gehört. Nach einer Weile frage ich mich, ob ich für jede Diskriminierung, die ich erlebe, vielleicht Punkte sammle und wenn ich das Bonus-Level erreicht habe, bekomme ich dann die richtige Diagnose? Leider nein. Nach dem ersten Jahr hatte ich so viele falsche Diagnosen, dass ich ein Sammelalbum daraus hätte machen können und war gleichzeitig so traumatisiert von der endlosen Ärzt*innen-Odyssee, dass mich auch heute noch jedesmal die Angst überkommt, wenn ich neue Mediziner*innen aufsuchen muss.

#61 Mediziner*innen mit Behinderung (Teil 2)
In Folge 61 unseres Bayern 2 Podcasts haben wir zum zweiten Mal Dr. Leopold Rupp und Hannah Hübecker zu Gast. In dieser Fortsetzung von Episode 60 sprechen darüber, wie gut bzw. schlecht die Gesundheitsversorgung für behinderte Menschen in Deutschland ist. Wir schauen unter anderem, welche Barrieren es im Gesundheitssystem gibt, wie sie sich je nach Behinderungsart oder Geschlecht verändern und was das alles mit dem Begriff Gaslighting zu tun hat.
Da war der Zug des Vertrauens dann abgefahren, aber keine Sorge – die psychosomatische Draisine bringt dich ganz bestimmt irgendwohin. Vielleicht in die Burnout-Klinik? Nicht, dass ich mich über psychische Erkrankungen lustig machen will – die bringen genauso viele, nur andere, Herausforderungen mit sich. Doch ist es eben wichtig, nicht körperliche Symptome mit psychischen zu verwechseln oder andersrum, weil sonst auf beiden Seiten viel Schaden angerichtet wird. Zum Beispiel kommt es durch psychische Fehldiagnosen bei EDS-Betroffenen dazu, dass sich die Zeit bis zur korrekten Diagnose auf 22 Jahre verlängert!
Doch während ich im Wartehäuschen auf den Zug mit besserer Versorgung für EDS-Betroffene warte, gibt es andere, die noch nicht einmal einen Bahnsteig haben. Eine davon ist Josefine, deren beide Kinder (9 und 13 Jahre) an ME/CFS erkrankt sind – eine ebenfalls komplexe, oft nicht sichtbare und vor allem medizinisch ignorierte Erkrankung. Die große Tochter, Samira, hat die ME/CFS-Diagnose erst seit einem Jahr, obwohl sie schon seit über 2,5 Jahren schwer krank ist. „Die ersten Symptome waren bei Samira hauptsächlich kognitiv. Sie hatte gerade eine COVID-Infektion und war im Übergang zum Gymnasium. Ihre Noten sind abgestürzt und im Fach Deutsch, in dem sie immer gut war, hat sie plötzlich Wörter falsch geschrieben, die sie vorher perfekt konnte.“ Über die Monate danach schritt die Erkrankung bei Samira weiter fort. Sie konnte nicht mehr zur Schule gehen und irgendwann auch ihr Zimmer nicht mehr verlassen.
ME/CFS
ME steht für Myalgische Enzephalomyelitis, CFS für Chronic Fatigue Syndrome (oder zu deutsch: Chronisches Erschöpfungssyndrom). Letztere Bezeichnung ist allerdings irreführend, denn ME/CFS geht weit über Erschöpfung (Fatigue) hinaus. Sie ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die neben der Erschöpfung mit einer Vielzahl anderer Symptome, wie kognitiver Dysfunktion und orthostatische Intoleranz einhergeht und gekennzeichnet ist durch die post-exertionelle Malaise (PEM), eine massive Zustandsverschlechterung nach jeglicher Form der Belastung – oft auch als „Belastungsintoleranz“ bezeichnet – die Tage oder Wochen anhält und in einem Crash enden kann. Ein Crash bei ME/CFS ist ein plötzlicher, oft verzögerter Zusammenbruch des körperlichen und kognitiven Zustands nach minimaler Anstrengung, der durch eine Verschlimmerung aller Symptome gekennzeichnet ist.
Über ein Jahr suchte Samiras Familie nach Mediziner*innen, die ME/CFS diagnostizieren. Obwohl das junge Mädchen alle Kriterien erfüllte und alle objektivierbaren Testungen für ME/CFS sprachen, weigerten sich die Ärzt*innen eine Diagnose zu stellen oder gar eine hilfreiche Therapie einzuleiten. Stattdessen wird der Familie dazu geraten, die damals 11-jährige alleine, ohne elterliche Unterstützung, in eine psychosomatische Klinik zu bringen. „Ich kann nicht nachvollziehen, wie das passieren konnte. Jeder wusste, Samira hat ME/CFS, aber trotzdem wurden wir dazu gedrängt unsere Tochter, die gerade in kürzester Zeit alle körperlichen Fähigkeiten verloren hat und nicht mehr aus dem Bett kann, alleine in einer Klinik zu lassen, die uns nicht mal gesagt hat, was dort mit unserem Kind geschieht“, sagt Mutter Josefine.
Wie bei vielen anderen komplexen und unverstanden Krankheitsbildern, kommt es auch bei ME/CFS häufig zu psychischen Fehldiagnosen. Manche Mediziner*innen gehen auch heute noch fälschlicherweise davon aus, ME/CFS sei selbst eine psychische Erkrankung, obwohl diverse Studien das seit Jahrzehnten widerlegen. Im Schnitt bekommen ME/CFS-Betroffene in der Schweiz 2,6 Fehldiagnosen, bis ME/CFS erkannt wird. Bis Betroffene in Deutschland korrekt diagnostiziert werden, vergehen mindestens sieben Jahre! Schlimmer noch: 90 Prozent erhalten nie eine (korrekte) Diagnose. Die Konsequenzen von solchen Fehldiagnosen sind bei ME/CFS noch gravierender als bei EDS, denn die meisten Betroffenen haben eine Lebensqualität, die ohnehin schon schlechter ist als die von anderen chronischen Kranken wie z. B. Personen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Multiples Sklerose und rheumatoider Arthritis. Schweres ME/CFS ist vergleichbar mit Krebs im Endstadium. Milder Verlauf bedeutet in der ME/CFS-Welt, dass man noch halb so viel Aktivität tolerieren kann wie ein Gesunder. Am anderen Ende des Spektrums, wenn Betroffene sehr schwer ME/CFS haben, bedeutet das oft, dass sie überhaupt keine äußeren Reize tolerieren können und so zuhause in einem dunklen Raum ohne jegliche Kommunikation ausharren müssen. Falsche Therapien, vor allem die, die auf „Aktivierung“, also auf einer Form der körperlichen Aktivität beruhen, können dazu führen, dass Betroffene „crashen“, das heißt, ihre Symptome verschlechtern sich akut und manchmal bleibend! Die ME/CFS-Erkrankten, die vor einer Fehldiagnose vielleicht mild betroffen waren und so noch ein wenig am Leben teilhaben konnten, sind eventuell danach schwer betroffen und verschwinden komplett aus der gesellschaftlichen Mitte. „Als wir im Krankenhaus waren, wollte sich niemand mit den ME/CFS-spezifischen Informationen befassen. Schließlich crashte Samira nach einer Physiotherapie-Behandlung so stark, dass sie elf Monate lang ihre Beine gar nicht mehr bewegen konnte“, erzählt Josefine.
Als wir im Krankenhaus waren, wollte sich niemand mit den ME/CFS-spezifischen Informationen befassen.
Wenn Ärzt*innen Symptome nicht ernst nehmen oder Patientinnen einreden, ihre Beschwerden seien „nur psychisch“, spricht man von „medical gaslighting“. Dabei handelt es sich um eine subtile Form der emotionalen Manipulation, bei der Betroffene zunehmend an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln. Besonders Frauen mit komplexen, oft unsichtbaren Erkrankungen erleben dieses Phänomen – nicht zuletzt wegen eines tief verankerten Gender Bias im Gesundheitssystem. Dieser sorgt dafür, dass vor allem bei Frauen Schmerzen bagatellisiert, Beschwerden psychologisiert und Diagnosen verzögert oder gar nicht gestellt werden. Seit der Covid-Pandemie ist der Begriff „medical gaslighting“ vermehrt in den Fokus gerückt – und für viele längst bittere Realität.
Was passiert, wenn Frauen mit EDS nicht geglaubt wird, hat uns jüngst ein tragisches Beispiel aus Neuseeland gezeigt. Drei Frauen mit EDS starben, weil ihnen die dringend benötigte medizinische Hilfe verweigert wurde. Trotz ihrer EDS-Diagnose wurden ihre Symptome heruntergespielt und nicht ernst genommen. Das fatale Ergebnis: Sie starben an den Komplikationen der Erkrankung. Ähnliche Fälle gibt es auch in Deutschland – nur wird darüber leider nicht gesprochen. Eltern von kranken Kindern – unabhängig davon, ob es sich um EDS oder ME/CFS handelt – wird vor allem vor der korrekten Diagnosestellung im schlimmsten Fall auch Kindesmissbrauch unterstellt.
„Als Samira nicht mehr Essen und Trinken konnte und alle therapeutischen Optionen ausgeschöpft waren, haben wir im Krankenhaus von Literatur berichtet, die in solchen Fällen das Legen einer PEG-Sonde [eine künstlich angelegte Ernährungssonde, die direkt durch die Bauchdecke in den Magen gelegt wird] empfiehlt. Daraufhin wurden wir wegen Kindeswohlgefährdung angezeigt“, erinnert sich Josefine. In der Folge erhielt Samire über Monate keine adäquate Therapie.
Erst kürzlich haben der Dokumentarfilm „Complicated“ und die Netflix-Doku „Take Care of Maya“ die strukturellen Probleme, die solchen falschen Anschuldigungen in den USA zugrunde liegen, aufgedeckt. Die sind auch auf viele andere Länder mit ähnlicher medizinischer Versorgung und Kultur übertragbar.
Nach zweieinhalb Jahren bekommt Samira endlich die Diagnose ME/CFS. Mittlerweile kann Samira ihr Bett nicht mehr verlassen, erträgt keine lauten Geräusche und kommuniziert nur an guten Tagen 10-15 Minuten mit ihrer Familie. Den Rest ihrer Zeit verbringt Samira in einem abgedunkelten Raum ohne sensorische Reize. Mit der Diagnose hat Samira das größte Hindernis überwunden, aber das heißt nicht, dass es danach einfach wird.

Behinderung und Barrierefreiheit im Gesundheitswesen
Auch 2023 sind viele deutsche Arztpraxen nicht barrierefrei, wodurch behinderten Menschen weiterhin der Zugang zum Gesundheitssystem verwehrt wird. Wir haben uns gefragt: Wie steht es in Deutschland wirklich um die Barrierefreiheit medizinischer Einrichtungen und wissen Mediziner*innen eigentlich, wie wichtig das Thema ist? Karina Sturm sprach mit vier Ärzt*innen aus verschiedenen Bereichen.
„Dieser Bahnhof wird derzeit nicht angefahren.“
Hast du mal versucht, mit dem Rollstuhl erste Klasse in der Bahn zu fahren? Das war eine Fangfrage, denn es gibt für Rollstuhlfahrer*innen keine Plätze in der ersten Klasse. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Gesundheitssystem. Ständig wird behauptet es gäbe keine Zweiklassenmedizin – ähnlich wie die Bahn so tut, als wäre der Service für die Rollstuhlfahrer*innen fast wie in der 1. Klasse – doch die meisten behinderten Menschen werden wie zweite Klasse Patient*innen behandelt, wenn sie medizinische Behandlungen aufsuchen. Neben der rein physischen Barriereunfreiheit vieler Arztpraxen, stehen Personen wie mir aber noch andere Hürden im Weg. Beispielsweise gibt es deutschlandweit keine einzige Anlaufstelle in Form eines Zentrums für EDS. Es gibt auch nicht für alle Komplikationen von EDS eine*n Spezialist*in und das, obwohl Betroffene laut einer Studie die Unterstützung von mindestens 12 Fachrichtungen benötigen. Das bedeutet: Wer überhaupt die Kraft – und das nötige Kleingeld – hat, sich auf eigene Faust weiter durchzubeißen, muss sich oft im Ausland behandeln lassen. Denn dort gibt es manchmal noch Fachleute die nicht sofort schreiend weglaufen, wenn sie „multisystemisch“ hören. In Deutschland hingegen haben sich die wenigen Expert*innen, die es überhaupt gab, längst aus der kassenärztlichen Versorgung verabschiedet. Kein Wunder: Die Behandlung komplexer, chronisch kranker Patient*innen ist im aktuellen System ein Verlustgeschäft – wirtschaftlich, zeitlich, nervlich. Denn für das Gesundheitssystem sind wir wie ein Regionalzug mit 50 Minuten Verspätung, ohne Klimaanlage und mit kaputtem Klo: keiner will uns fahren, weil es sich einfach nicht rentiert – und am Ende werden wir aus dem Fahrplan gestrichen.
Doch besser tot?
Wenn ich davon spreche, wie Menschen mit EDS, ME/CFS, Long Covid und vielen anderen der ignorierten Erkrankungen auf der ganzen Welt im Stillen sterben, werde ich häufig ungläubig angestarrt. Für diese Communities ist das bittere Realität. In Kanada gab es in letzter Zeit vermehrt Fälle, in denen Menschen mit EDS und behandelbaren Komplikationen – eine Behandlung in einem anderen Land wäre verfügbar – stattdessen Sterbehilfe angeboten wurde. Das sind junge Menschen, die mit der richtigen Behandlung noch 30-40 Jahre leben würden. Das passiert auch Menschen mit anderen Behinderungen beispielsweise in den Niederlanden, wo mehrere autistische Menschen gestorben sind – nur um gleich mal dem Einzelfall-Narrativ entgegenzuwirken. Sowas gäbe es in Deutschland nicht, wird mir dann normal gesagt; dafür seien wir viel zu gut in allem. Dem ist aber nicht so. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile Menschen, für die die Einschränkungen der Lebensqualität so groß und die Unterstützung so gering ist, dass der Tod eine bessere Option darstellt. Die Bahn bietet wenigstens eine Rückerstattung bei Komplettausfall. Das System hier? Bietet dir Sterbehilfe, wenn die Versorgung zu teuer oder schwierig wäre.
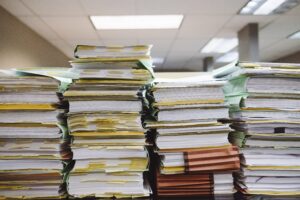
Jung und Behindert: Im System nicht vorgesehen
Junge, kranke, behinderte Menschen sind im System nicht vorgesehen. Unsere Autorin wurde in jungen Jahren chronisch krank und behindert und musste sich durch die vielen Herausforderungen der Bürokratiewüste Deutschlands quälen: Beantragungen von Rente, Krankengeld, Hilfsmitteln und mehr füllen ihren Tag aus. Oft werden die Anträge abgelehnt, weil sie für die jeweiligen Gutachter nicht krank genug aussieht. Karina Sturm spricht mit den Verantwortlichen über Ursachen und Konsequenzen dieses Problems.
„Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten während der Fahrt.“
Durch die mangelnde Gesundheitsversorgung leben viele Menschen mit chronischer Erkrankung oft am Existenzminimum. Chronisch krank zu sein ist teuer. Gleichzeitig ist die Lebensqualität vieler Menschen wie mir extrem schlecht, weil sie keine medizinische Unterstützung haben und demnach auch kein Management der Symptome. Viele sind arbeitsunfähig und auf soziale Absicherung angewiesen. In der Theorie klingt die in Deutschland solide: Wer länger erkrankt ist, bekommt irgendwann eine Erwerbsminderungsrente. In der Praxis fühlt sich dieser Übergang jedoch eher an wie ein Zug, der angekündigt wurde, aber nie einfährt – oder bestenfalls am falschen Gleis hält.
Rund 40 Prozent der Erstanträge auf Erwerbsminderungsrente werden abgelehnt. Das passiert bei seltenen oder nicht sichtbaren Erkrankungen wie dem Ehlers-Danlos-Syndrom oder ME/CFS besonders häufig. Selbst wenn man erhebliche funktionelle Einschränkungen im Alltag hat, reichen diese laut Gutachten oft nicht aus.
Dabei sind es nicht selten die Begutachtungen selbst, die das Problem verstärken: Unkenntnis über komplexe Krankheitsbilder, Entscheidungen nach Aktenlage oder fehlerhafte Einschätzungen durch nicht spezialisierte Gutachter*innen führen dazu, dass viele Betroffene das Gleis mehrfach wechseln müssen – vom Antrag zum Widerspruch, weiter zur Klage. Dieser Umstieg kostet Kraft, Zeit und in vielen Fällen auch Geld – alles Dinge, die Personen mit Erkrankungen, die geprägt sind von Fatigue und Schmerz, nicht haben.
Das System ist dabei auf Verzögerung ausgelegt. Eine Erwerbsminderungsrente über viele Jahre zu zahlen, ist für die Rentenversicherung teuer. Und so bleibt die Hürde hoch, gerade für junge, chronisch kranke Menschen. Wer nicht mehr in der Lage ist, den Kampf zu führen, bleibt auf dem falschen Bahnsteig stehen – während der Zug der Absicherung an einem anderen vorbeifährt. Mehr als einen Zug gibt es aber nicht. Die Konsequenz: Wohnungslosigkeit oder völlige Abhängigkeit von Familie oder Partner*innen – wenn man überhaupt jemanden hat. Manche landen in Einrichtungen, andere im Bett, mit Pflegestufe, aber ohne Unterstützung. Und einige verschwinden einfach. Aus Statistiken. Aus Wartezimmern. Aus dem Leben.
Endstation
In Deutschland wird gerne behauptet, dass wir niemanden zurücklassen. In der Realität jedoch bleiben Menschen mit komplexen chronischen Erkrankungen oft nicht nur zurück – sie werden aktiv ausgebremst. Ob Ehlers-Danlos-Syndrom, ME/CFS, Long Covid oder andere multisystemische Erkrankungen: Die Versorgung ist lückenhaft, die Anerkennung gering, die Unterstützung ein Glücksspiel – und stark von Privilegien abhängig.
Wir brauchen keine Sonderbehandlungen, keine goldenen Schienen – wir brauchen ein System, das nicht automatisch bei Unwissen die Verantwortung abgibt, sondern bei Unsicherheit erst recht hinschaut. Wir brauchen Strukturen, die mehr leisten als kosmetische Inklusion und Verweilverlängerung im Wartezimmer. Und wir brauchen vor allem eins: ein Menschenbild, das uns nicht als „zu kompliziert“ und „lohnt sich nicht“ abspeichert und aussortiert, sondern die Vielfalt auch in der Medizin endlich ernst nimmt.
Bis dahin bleibt nur eines: sich gegenseitig Starthilfe geben. Denn wenn der Zug schon nicht fährt, dann schieben wir ihn eben gemeinsam an – auch wenn es immer nur bergauf geht. „Ich will einfach nur, dass jeder diese Erkrankung kennt und erkennt, sodass man verhindern kann, dass die Kinder in einen schlechteren Zustand kommen. Bei Samira hätte viel davon verhindert werden können. Nur deswegen spreche ich über ME/CFS“, endet Josefine.



7 Antworten
Ein toller Artikel, den ich gerne teile.
Wenn ich richtig informiert bin, kann EDS ein Auslöser für ME/CFS sein.
Ihnen alles Gute und Dank für Ihr Engagement trotz eigener Erkrankung.
Gruß von einer ME/CFS-Betroffenen.
Traurig aber leider wahr… fantastisch geschriebener Artikel, vielen Dank dafür!
… aus dem Leben. …
Gerade erst von meinen Anwalt erfahren (kämpft für mich gegen meine BU Versicherung): Mandantin, 18. Jahre jung, mit schwerem ME-CFS, begeht zusammen mit der Mutter Suizid.
–> und selbst solch ein tragischer Fall findet medial nicht statt
Obwohl ich selbst betroffen bin, frage ich mich, gibt es passende Systeme dafür? Auf Basis meiner verschiedenen internationalen FB Gruppen wohl eher nicht.
Glückwunsch zu diesem gelungenen Beitrag und der herrlichen Bahn-Analogie. Solche Beiträge helfen zumindest das Verständnis im Umkreis von Freunden und Verwandten zu schärfen – was auch schon oft schwierig ist.
Bleibt stark!
Liebe und hoffnungsvolle Grúße
Kim (mit ME/CFS, Post-Covid, Herz, SFN, Hypertonie, jetzt auch noch Lunge usw. )
Erkrankt an ME/CFS 2001
Arbeitsunfähig 2013
EM-Rentenantrag 2013
ME/CFS Diagnose 2017
Bettlägerig 2018
Antrag Pflegegrad 2018
Antrag GdB 2021
EM-Rente 2022
Pflegegrad erhalten 2023
GdB ist noch im Kampf.
Danke für den Artikel. Hier muss sich systemisch etwas ändern, damit jeder Mensch unabhängig von Geschlecht und Erkrankung die Hilfe bekommt, die er benötigt.
Danke, der Artikel ist so verständlich und gut verfasst worden und der Bahn-Vergleich versinnbildlicht diese ganze traurige Situation perfekt. Man sollte wirklich meinen, dass er verantwortliche Menschen in ausreichendem Maße auch mental erreicht und er so doch etwas bewirken muss. Doch unser System ist leider zu sehr vom Leistungswahn gesteuert und die gedrillten Leistungsmaschinen können bzw. wollen nicht glauben, dass es auch andere Menschen gibt, deren Organismus dazu eben nicht mehr imstande ist.
Abermals herzlichen Dank für die aussagekräftige Beschreibung trauriger aber wahrer Lebensumstände sehr vieler kranker Menschen.
Ralf, 57 J., seit über 20 Jahren an ME/CFS erkrankt und Diagnose erst seit 2023
Vielen Dank für diesen fantastischen Artikel!
Ich hatte sehr viel Glück und habe meine ME/CFS Diagnose “schon” nach fünf Jahren erhalten (viele Ärzte in der Familie, die sich für mich interessieren und eine, die schonmal von der Erkrankung gehört hat + ich bin 2019 erkrankt, deswegen haben sich Ärzte auch bald entsprechend fortgebildet); allerdings habe ich keinerlei Hinweise von meinen Ärzten bekommen, dass pacing wichtig ist. Als ich das ein halbes Jahr später selbst herausgefunden habe, war es schon zu spät und mehrere heftige Crashs haben zu einem schweren Verlauf geführt.
Ich habe auch Glück, weil ich ein gutes soziales Netz habe mit meiner Partnerin und zwei Freundinnen, die mich pflegen; meinen Eltern, die alles bürokratische erledigen und einmal die Woche bei uns aushelfen; mit Freunden, Geschwistern und Großeltern, die spontan bei irgendwas helfen. Außerdem hatte ich bei der Pflegegutachterin unglaubliches Glück und habe direkt Pflegegrad 3 bekommen und sogar einen Pflegedienst (für 1 h am Tag, yay) gefunden, was dann die Leute vom GdB doch dazu bewogen hat, einzusehen, dass ich doch schon tatsächlich behindert bin. Sogar meine Ärzte lernen langsam aber sicher über meine Erkrankung.
Alle diese Menschen sorgen dafür, dass ich überlebe und zumindest noch ein bisschen Spaß am Leben habe, aber alle arbeiten an ihrem Limit. Hilfe vom Staat (Hilfsmittel, Geld, Assistenz etc.) kommt, wenn überhaupt, Monate bis Jahre zu spät. Hätte ich die Menschen um mich herum nicht, wäre ich vielleicht ins Krankenhaus gebracht worden, was einen Crash verursacht hätte, wahrscheinlich hätte ich vieles gegessen, auf das ich allergisch reagiere und vielleicht wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. Die Idee, Gelder erst auszuzahlen, wenn man sich absolut sicher ist, dass die Person ein Recht darauf hat, ist absurd. Ich brauche diese Sachen ab Tag 1! Und Menschen, die diese Gelder brauchen, haben nicht die Energie, hunderte Anträge auszufüllen! Man kann nicht davon ausgehen, dass das soziale Umfeld von Haushaltsaufgaben bis zur künstlichen Ernährung alle Pflegeaufgaben übernimmt, denn manchmal existiert dieses Umfeld einfach nicht.
Ein weiterer Punkt: mit einer “milden” oder “moderaten” ME/CFS hat man kaum Chancen auf Hilfsmittel, Pflegegrad, etc., weil Ärzte und Behörden PEM und das mit den Löffelchen nicht verstehen. Nur, weil ich an guten Tagen mir ein Brot schmieren kann (auf Kosten vieler anderer Aktivitäten an diesem Tag wie essen oder aufs Klo gehen), heißt das nicht, dass ich im Alltag tatsächlich dazu fähig bin.
Weiterer Punkt: kaum ein Arzt oder Therapeut macht Hausbesuche (noch weniger als eine annähernd barrierefreie Praxis haben). Es fühlt sich sehr häufig an nach “ich bin zu krank für’s Gesundheitssystem”.
Ich habe noch eine tolle Diskriminierungserfahrung hinzuzufügen (und dann ist irgendwann mal gut): ich habe asthma und Heuschnupfen + Hausstauballergie etc. entsprechend huste ich häufig und habe immer mal wieder Schnupfen, wenn ich die Allergene nicht ganz draußen halten kann. Ich war 2021 bei meinem Lungenarzt und da gab es wegen Corona so einen Fragebogen, ob ich Husten oder Schnupfen habe. Nunja, am Ende habe ich einen (offensichtlich negativen) PCR Test, aber dafür keine Behandlung bekommen. Der nächste Termin war dann einen Monat später, weshalb ich meine Hyposensibilisierung erst ein Jahr später machen konnte.
Natürlich habe ich auch eine “Depression” ohne Antriebsstörung und ohne traurige Gefühle o.ä. sondern nur mit Erschöpfungs- und somatischen Symptomen ♀️ nicht angepasste Fragebögen sind was tolles.
Sorry für diesen langen Kommentar. Das waren sechs Jahre an angestauter Wut.
PS.: dafür dass EDS so selten ist, gibt es ziemlich viele Menschen, die darüber aufklären. Ich bin gespannt, wie “selten” es in 10-20 Jahren ist, das klingt nach sehr vielen Menschen ohne Diagnose…
Karina, Du hast das ziemlich auf den Punkt gebracht; vielen Dank dafür.
Ich befürchte allerdings, dass das nur Betroffene lesen, die “Anderen” werden sich wahrscheinlich vor der Mitwirkung mit “oh, soo kompliziert; das hatten wir noch nie; haben Sie es schon mal mit Hypnose probiert” davonstehlen.
Bei mir ist es “nur” Morbus Wegener/GPA. Das fällt ist den Systemkreis Rheuma und schwupp ist der Diagnosestempel Rheuma da. Und Rheuma ist dann oft gleichbedeutend mit Arthritis, voila´, da haben wir dann die Sackgasse. Dass aber die Luftröhre zuwuchert, die Nieren am Limit sind und der komplette Nasenraum dicht ist sowie eine plötzliche, überfallartige Müdigkeit und permanente Schmerzen ja auch noch da sind, dies wird gerne mal ausgeblendet. Rheuma in den Blutgefäßen kann halt überall im Körper aktiv sein und sehr oft an mehreren Stellen zur gleichen Zeit. Ja, die Ärzte sind nett und das Krankenhauspersonal ist wie alte Freunde, die man halt 2 bis 3 mal im Jahr sieht. Aber alles kostet Zeit, Geld und Kraft. Und ich will ja noch arbeiten. Teil-Erwerbsminderungsrente zu bekommen, war extrem nervenaufreibend und ohne Anwalt nicht zu schaffen. Das “Hobby” Multisystemische Erkrankung darf man nur betreiben, wenn man viel Geld, viel Zeit, viel Kraft und starke Nerven hat. Wer das alles hat, ist aber eben eher nicht krank.
Aber ich habe Glück und eine taffe Rheumatologin, die das Ungeheuer GPA im Schach halten kann. Bei 130 Personen von 1 Million Personen ist es erfreulicher Weise zumindest so, dass es finanziell lukrativ für Pharmaunternehmen ist.
Ansonsten habe ich immer das Gefühl, falsch aufgehoben zu sein und kann Ärzte verstehen, die erleichtert zur Kenntnis nehmen, dass da schon eine Diagnose vorliegt: “Sie haben Rheuma, würden Ihnen Moorbäder helfen?” Da kann man nur sagen: Nett gemeint und Danke, nein!