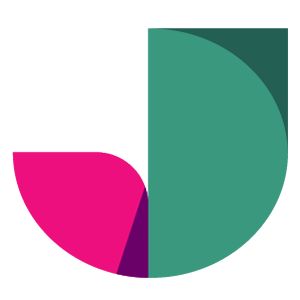Das System der Werkstätten für behinderte Menschen muss sich verändern. Neben der Forderung nach einem Mindestlohn für die Beschäftigten, gibt es noch viele weitere wichtige Punkte, die umgesetzt werden müssten. Wir bieten fünf Schritte in die Veränderung an, die alle Akteur*innen mit einbeziehen
Seit Jahren wird heftig darüber diskutiert, wie Werkstätten für behinderte Menschen reformiert werden können oder durch welche Alternativen sie ersetzt werden müssen. Unabhängig davon, ob man eine Reform oder die Abschaffung des jetzigen Systems befürwortet, ist klar, dass Werkstattbeschäftigte – also die Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, die in einer Werkstatt tätig sind – dringend fair behandelt werden und bessere Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bekommen müssen. Die Kritik am System der Behindertenwerkstätten wird immer deutlicher und hat zur Folge, dass z.B. die Forderung nach einem Mindestlohn für Werkstattbeschäftigte breit diskutiert und unterstützt wird, nicht zuletzt auch durch eine Petition auf change.org. Die Verantwortung für eine Veränderung des Werkstattsystems wird zwischen den Akteur*innen immer wieder hin und her geschoben. Sind es die Unternehmen, die anfangen müssen mehr Menschen mit einer Behinderung einzustellen? Ist es die Politik, die erst die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen muss, um Übergänge zu erleichtern? Oder sind es die Werkstätten, die ihre Beschäftigten besser ausbilden und vermitteln müssen? Wir sind der Meinung, es müssen alle zusammen daran arbeiten und stellen fünf Empfehlungen vor, die in einem ersten Schritt kurzfristig von allen Akteur*innen gemeinsam umgesetzt werden können.
1. Eine unabhängige Beratung für Werkstattbeschäftigte
In vielen Werkstätten werden die Beschäftigten nicht ausreichend über Alternativen zu den Werkstätten informiert. Das hat unterschiedliche Gründe. Viele Werkstätten haben kein Interesse ihre leistungsstärksten Beschäftigten aus der Werkstatt raus zu vermitteln. Andere Werkstätten sparen am Geld für Personal im Übergangsmanagement oder sind selber unzureichend über die Alternativen informiert. Das Ergebnis ist, dass bestehende Alternativen nur ganz selten benutzt werden. Das Budget für Arbeit zum Beispiel, das als wichtige Alternative zur Werkstatt vor drei Jahren eingeführt wurde, wurde erst 1.000 Mal in ganz Deutschland genutzt, obwohl 320.000 Menschen in Werkstätten beschäftigt sind. Neben den oben genannten Gründen liegt dies auch daran, dass das Gesetz nicht regelt, wer dafür verantwortlich ist, Werkstattbeschäftigte bei der Ausführung des Budgets für Arbeit zu begleiten.
Eine unabhängige Beratung für Beschäftigte in Werkstätten sollte mit dieser Aufgabe beauftragt werden. Bundesweit gibt es bereits unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EUTB), die nach der sogenannten Peer-Counseling Methode arbeiten. Peers nennt man Personen aus einer Gruppe mit gleichen oder ähnlichen Erfahrungen. In den EUTBs arbeiten viele Peer-Berater*innen, die selbst mit einer Behinderung leben. Dieses erfolgreiche Konzept der EUTBs sollte auf die Beratung von Werkstattbeschäftigten erweitert werden. Die Peer-Berater*innen werden beauftragt, die Werkstattbeschäftigten zweimal jährlich aufzusuchen, über Alternativen zur Werkstattbeschäftigung aufzuklären und gegebenenfalls an entsprechende Angebote zu vermitteln.
2. Erhebung von Vermittlungsdaten der Werkstätten
Derzeit liegt die Vermittlungsquote von Beschäftigten aus den Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt im Durchschnitt bei etwa 1 %. Welche Werkstattstrukturen erfolgreicher ihren Vermittlungsauftrag ausführen und welche unter dem Durchschnitt liegen, wird derzeit nicht erhoben. Das Ergebnis ist, dass Werkstattbeschäftigte nicht wissen, welche Werkstattkonzepte am besten funktionieren und entsprechend eine Werkstatt für sich auswählen. Und Werkstätten können erfolgreiche Vermittlungskonzepte von anderen nicht übernehmen und weiterentwickeln. Es müssen Kriterien festgelegt werden, anhand dessen die Qualität der Vermittlungsbemühungen und der tatsächlich erfolgten Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt jährlich erhoben werden. So werden verlässliche Daten zur weiteren Evaluierung und Qualitätssicherung gesammelt, aufgrund dessen erfolgreiche Vermittlungskonzepte ausgebaut werden können.
3. Schaffen eines finanziellen Anreizsystems
Das Werkstattsystem wird großteils durch Zahlungen der Träger staatlicher Unterstützungsleistungen, in der Form von Tagessätzen pro Werkstattbeschäftigten, finanziert. Dazu kommen Einnahmen für Produktions- und Dienstleistungsaufträge, die die Werkstätten für Unternehmen und für die öffentliche Hand ausführen. Um planbar wirtschaften zu können, streben die Werkstätten daher eine Auslastung mit einer möglichst hohen Zahl von Beschäftigten an. So besteht kein finanzieller Anreiz für die Werkstätten ihre Beschäftigten aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Es gibt vereinzelt Bestrebungen, durch Trägerbudgets den Werkstätten Planungs- und Finanzierungssicherheit zu geben, unabhängig von der aktuellen Auslastung. Dieses Modell sollte bundesweit genutzt werden, um den Zwang und Druck zum Halten von Werkstattbeschäftigten zu verringern. Zusätzlich sollten finanzielle Anreize für die erfolgreiche Vermittlung von Werkstattbeschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen werden. Dies kann aus Mitteln des Ausgleichsfonds erfolgen. Der Ausgleichsfonds besteht aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, die Unternehmen zahlen, wenn sie nicht genügend Menschen mit Behinderung beschäftigen und dient zur Finanzierung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben z. B. durch Assistenz, Umbauten oder Hilfsmitteln.
4. Keine Minderung der Ausgleichsabgabe für Werkstattarbeit
Arbeitgeber*innen sind verpflichtet, Menschen mit Behinderungen anzustellen. Erfüllen sie ab einer bestimmten Unternehmensgröße diese 5 %-Quote nicht, müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen, die für Unterstützungs- und Integrationsleistungen an anderer Stelle eingesetzt wird. Arbeitgebende, die keine behinderten Menschen beschäftigen, können die Ausgleichsabgabe aber dadurch reduzieren, dass sie Aufträge an Werkstätten für behinderte Menschen vergeben. Damit werden diese Arbeitgebenden gleich dreifach für ihre mangelnde Inklusion belohnt: Sie entgehen dem Aufwand der Inklusion von Mitarbeiter*innen mit Behinderung, sie können 50 % der Ausgleichsabgabe einsparen und erhalten günstige Produkte und Dienstleistungen aus der Werkstatt. So gehen Mittel für den Ausgleichsfonds verloren und Beschäftigte, die in den Werkstätten Tätigkeiten für den allgemeinen Arbeitsmarkt offensichtlich ausführen können, kriegen keine Chance auf dem Arbeitsmarkt.
5. Zeitliche Beschränkung von Außenarbeitsplätzen
Aktuell arbeiten etwa 15.000 Werkstattbeschäftigte auf sogenannten Außenarbeitsplätzen. Die Beschäftigten arbeiten dabei in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts, sind aber nicht bei den Betrieben angestellt, sondern weiterhin bei der Werkstatt beschäftigt. Diese Möglichkeit, die als Sprungbrett in den allgemeinen Arbeitsmarkt gedachte war, erweist sich immer häufiger als Dauerlösung. So bleiben die Beschäftigten unterbezahlte Werkstattbeschäftigte und die Werkstätten erhalten weiterhin die Vergütungen vom Kostenträger. Die Betriebe können die Beschäftigten auf den Außenarbeitsplätzen auf ihre Schwerbehindertenquote anrechnen, und somit bei der Ausgleichsabgabe sparen, ohne irgendjemand einzustellen. Nur in etwa 5 % der Fälle wird ein*e Werkstattbeschäftige*r von einem Außenarbeitsplatz aus in den Betrieb übernommen. Durch die Einführung des Budgets für Arbeit, bei dem bis zu 75 % der Lohnkosten übernommen werden, und Unterstützungsleistungen wie Arbeitsassistenz könnten Unternehmen die Beschäftigten von einem Außenarbeitsplatz dauerhaft sozialversicherungspflichtig übernehmen. Um den Sinn und Zweck der Außenarbeitsplätze gerecht zu werden, empfehlen wir daher ausgelagerte Arbeitsplätze grundsätzlich auf zwei Jahre zu beschränken.
Dieser Artikel ist zuerst bei JOBinklusive erschienen.